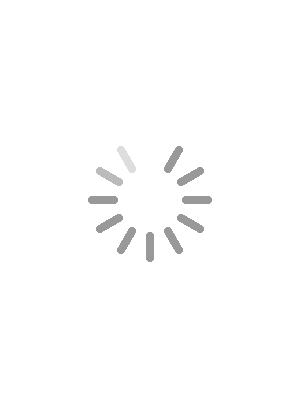
DokKa 4 Tag 2
Was ist ein Dokument?
Im Internet kann man so gut wie alles kaufen – likes und klicks, traffic auf der Seite und natürlich auch Kundenbewertungen aller Art. Auch Literatur-, Kunst-, Film- und Theater-Kritiken kann man bestellen. Ralph Schulz führt in seiner Installation „Testimonials“ vor, wie das geht. Auf dem Bildschirm sieht man Menschen vor neutralem Hintergrund oder in sterilem Interieur, im Auto oder an merkwürdigen Orten. Sie sprechen den Zuschauer direkt an und preisen ein unbekanntes Kunstwerk . Manchmal wiederholen sich Phrasen und schnell merkt der Zuschauer die Beliebigkeit der Aussagen. Das Geheimnis: Schulz hat diese Testimonials gekauft, hat die Texte selbst geschrieben und verschickt. Wenige Tage später erhielt er die fertigen Videos. Kritik und Werturteil als Dienstleistung. Kann man ihnen fortan trauen, wenn man sie auf websites sieht, im Fernsehen oder auf der Leinwand? Was ist ein Dokument?
Die Frage stellte sich auch bei der Hördokumentation „Born to work“ von Stefanie Heim. Sie reinszeniert, was sie nicht aufnehmen durfte und konstruiert, was sie sich gewünscht hätte. Ihr Tagebuch steht neben Interviews mit Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeitern. Heterogene Materialien verbindet sie artifiziell, um von der Eintönigkeit der Arbeit im Betrieb zu erzählen. Dokumentiert sie oder konstruiert sie ihre Geschichte? Ist das ganze Stück ein Dokument, oder sind es nur die einzelnen O-Töne? Das sind alte Fragen, die einer neuen Beantwortung harren. O-Töne können leicht zu Testimonials werden, wer kann das schon unterscheiden? Derart sensibilisiert werden einige Zuhörer skeptisch gewesen sein bei Christian Lerchs Hördokumentation „Papa, wir sind in Syrien“. Wie können die Voicemails so gleich klingen, aus Syrien so klar wie aus dem hessischen Kassel? Warum sprechen die verlorenen Söhne, die sich IS angeschlossen haben, so ein gutes Deutsch ohne Dialekt wie der Vater? Durch ein geschicktes Sounddesign hat der Autor die räumlichen Distanzen hörbar gemacht, Töne „verschlechtert“, um ihren dokumentarischen Charakter zu betonen. Müssen Dokumente erst hergestellt werden, um glaubwürdig zu werden? Da war der Film „Borderland Blues“ doch ziemlich oldfashioned frisch und wohltuend eindeutig. Gudrun Gruber zeigt einfach, wie es ist an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, begleitet Grenzschützer und Flüchtlingshelfer, Anwohner und Indigene. Trumps Vorstellungen einer Mauer muß sie gar nicht thematisieren, die hat der Zuschauer im Hinterkopf, wenn er sehen kann, wie kompliziert das Grenz-Problem ist. Sie schaut einfach hin. Das reicht, um ein Dokument zu schaffen. Wirklich?
