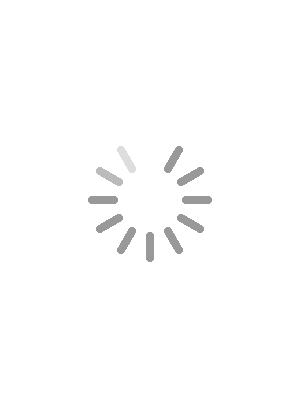
Sau des Monats - 03.01.2011
David Denk
David Denk, TAZ-Redakteur, über das Treiben um Julian Assange Es gab ihn vor Weihnachten schon als Krippenfigur: Die Ikonisierung des Julian Assange ist nicht mehr aufzuhalten. Dazu gehört auch, dass mittlerweile jedes Kind weiß, wie man den Nachnamen des australischen Mitgründers der Enthüllungsplattform Wikileaks ausspricht: Assange. As-san-ge. Und dass ein Leak ein Leck ist, eine undichte Stelle, wissen erst recht alle, seitdem Wikileaks geheime Dokumente veröffentlicht und mit Hilfe internationaler Großmedien wie New York Times, Guardian oder Spiegel Staatsaffären daraus macht. Doch etwas stimmt nicht mit der Assange-Krippenfigur, die als Agenturfoto um die Welt ging. Sie ist ein Fall für den Ramschtisch. Denn sie trägt noch die alte Assange-Frisur, die grauen, halblangen Haare, die doch längst einem braun gefärbten Kurzhaarschnitt mit blonden Strähnchen gewichen sind. Und nichts ist so alt wie der Promilook von gestern. Aus dem geheimnisvoll Frühergrauten ist auch optisch ein Popstar geworden, eine Art Ronan Keating der Netzaktivisten. Die Medien versuchen derweil das Mysterium Assange nach allen Regeln der Kunst auszuleuchten. Zu diesem Zweck zerren sie sogar seine Mutter vor die Fernsehkameras. Und die schlägt sich - oh Wunder - auf die Seite ihres Sohns. Eine ganz normale Frau, denkt man. Was nur belegt, wie entrückt Assange unserer Alltagwelt mittlerweile ist - zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Beim Milchkaufen kann man sich ihn nur noch schwerlich vorstellen - obwohl er ja wieder frei ist, so frei, wie man in seiner Position - mit Fussfessel - sein kann. Je häufiger Assange sein Styling ändert, desto höher wird sein ikonisches Potenzial. Denn das Ändern des Erscheinungsbilds korrespondiert prächtig mit dem Bild des politisch Verfolgten, den seine Unterstützer in Assange sehen. Der Jäger wird zum Gejagten, weil er den Mächtigen gefährlich geworden ist - dieses alte Muster des Agententhrillers übertragen seine Fans auf Assange. Dass gegen den offiziell wegen sexuellen Fehlverhaltens ermittelt wird, nährt da nur die Verschwörungstheorien. Die Unterstellung: Man will ihn durch eine Schmutzkampagne unmöglich machen und die ganze Bewegung mit in den Dreck ziehen. Wer "man" ist, wissen auch die Wikileaks-Unterstützer nicht so genau. Sie vermuten: Amerika und mehr. Die Kündigung der Zusammenarbeit durch US-Konzerne und die Verfolgungshysterie gegen Assange und die Bewegung in den USA sind ihnen Beweis genug, dass es nur eine Art Weltverschwörung sein kann, der Assange auf die Schliche gekommen ist. Überhaupt muss Assange in den letzten Woche eine Erfahrung machen, die schon viele Popstars vor ihm gemacht haben: Man kann sich seine Fans nicht aussuchen. Die Rede ist nicht von finanzkräftigen Unterstützern wie Bianca Jagger und Michael Moore, die für seine Kaution aufgekommen sind. Deren Wort hat Gewicht. Der Protest vieler anderer hat noch nicht mal ein Gesicht. Hinter Masken verborgen hat die Hackergruppe "Anonymous" zur "Operation Payback" aufgerufen, zur Vergeltung für Assange und Wikileaks. "Anonymous" bombardiert in konzertierten Aktionen die Websites abtrünniger US-Konzerne. David gegen Goliath - nur diesmal könnte die Geschichte anders ausgehen. Denn die Firmen spüren die auf sie geschleuderten Steinchen kaum. Und der Nutzen für Wikileaks ist auch fraglich. Für "Anonymous" leben wir längst im Krieg. Es geht um Informationsfreiheit, um das Verhältnis von Transparenz und Geheimniskrämerei in westlichen Demokratien, um die Kontrolle der Macht von Wirtschaft und Politik. Doch kann bislang niemand mit Bestimmtheit sagen, wie groß und nachhaltig die Auswirkungen vergangener und kommender Wikileaks-Enthüllungen tatsächlich sein werden. Der medial verbreiteten Aufregung kann auch schnell der erste Kater folgen. Die Missbrauchsvorwürfe gegen Assange sind dagegen wesentlich handlicher. Da weiß man, was man hat. Und deswegen stürzt sich selbst der seriöse Guardian auf all die schmutzigen Details, zitiert genüsslich aus den Ermittlungsakten der schwedischen Staatsanwaltschaft. Von Wikileaks zugespielt wurden die dem Guardian sicherlich nicht. Diesmal nicht. Anders als die Enthüllungsplattform ist solch eine Berichterstattung nichts Neues, sondern Boulevardjournalismus ganz alter Schule: Blut und Sperma sind das Lebenselixier der Untenrum-Journalisten. Das Thema Assange und Wikileaks zeigt sowieso sehr schön, dass die Reflexe der Branche noch einwandfrei funktionieren. Die Veröffentlichung der US-Botschaftsdepeschen durch Wikileaks konnten etablierte Medien nicht ignorieren, gleichzeitig waren ihnen diese aus dem Nichts aufgetauchten Internetfreaks auch suspekt. Aus einem einfachen Grund: Besonders Printjournalisten begreifen das Internet als Bedrohung. Auch wenn viele nicht mehr wüssten, wie man ohne Google recherchiert. Das Internet ist immer schneller, immer billiger, meistens sogar umsonst. Es stellt das Geschäftsmodell der Verlage in Frage - und deren Angestellte treten immer wieder reflexhaft als plumpe Besitzstandswahrer auf. Und so war zunächst viel von der Gefahr die Rede, die die ungefilterten Wikileaks-Enthüllungen im Internet für unschuldige Zivilisten bedeuten könnten. Dass Wikileaks - auch um diese Menschen zu schützen - die Dokumente von etablierten Printmedien auswerten lässt, die dadurch mitverdienen, hatten die Kollegen offenbar noch nicht verstanden. Es zeigte sich wieder einmal, daß es kundiger Journalisten bedarf, um nicht in der rasant steigenden Informationsflut des Internets unterzugehen. Es wird sich immer mehr als nützliche Quelle erweisen, eine unter vielen, mehr nicht. Inzwischen hat sich bereits die erste Hysterie gelegt. Im Internet kursiert ein "Appell gegen die Kriminalisierung von Wikileaks". Zu den Erstunterzeichnern gehören - man höre und staune - sogar einige Tageszeitungen, auch die TAZ.
Popikone Assange
#1379 / O-Ton / mit Geodaten / Dokublog
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
