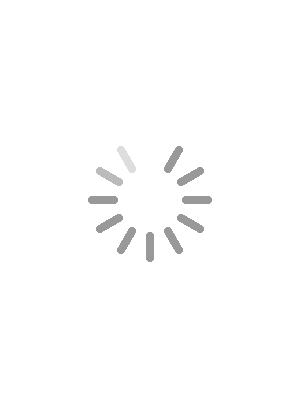
"Warum das Hören eine große Zukunft hat"
Essay von Alexandra Borchardt

Den Augen eine Pause gönnen – Warum das Hören eine große Zukunft hat Von Alexandra Borchardt Man kann die Zukunft des Radios in seiner Vergangenheit suchen. Dabei drängt sich ein Bild auf, das man aus Erzählungen kennt. Wie sich Familien im Tosen des Zweiten Weltkriegs um ihre Radios scharten, ehrfürchtig still, die Hand am Drehknopf suchte das verbotene Signal. Der Ton war schon auf Leise gestellt, die Nachbarn sollten nichts mitbekommen. Millionen Deutsche hörten während des Krieges regelmäßig das deutsche Programm der britischen BBC – Feinsender, so hieß das damals. Für die meisten von ihnen war es die einzige Verbindung zu einer Welt, in der es Informationen gab, nicht Propaganda. Ein Hort der Hoffnung, Teil einer Überlebens-Strategie. Auch heute sind Medien in vielen Teilen der Welt voll von Propaganda. Das Radio verbreitet sie, mehr noch das Fernsehen, vor allem die sozialen Netzwerke. Dem Lauten und Schrillen, den verdrehten Wahrheiten, den Lügen, manchmal kann man ihnen selbst hierzulande kaum entkommen. Aber anders als damals in der Nazi-Diktatur ist echte Information keine knappe, keine abgeschirmte Ware mehr. Wer will, kann sie finden, praktisch überall auf der Welt. Nur: Nicht jeder findet sie. Ein Graben tut sich auf zwischen denjenigen, die wissen, wo sie suchen müssen in den Weiten des Internets und den anderen, die gar nicht erst auf die Suche gehen. Man spricht auch vom digitalen Graben. Die Geiseln der digitalen Kommunikation sind die Ablenkung, der Überfluss, das Übermaß. Wer früher Zeitung las, Radio hörte, sich durch die Fernseh-Programme zappte, tat dies vielleicht aus Langeweile, bevor er irgendwo gebannt hängen blieb. Heute ist diese Chance gering. Man kann zu jeder Zeit und an jedem Ort chatten, spielen, shoppen. Ein Zuviel an Reizen, Angeboten, Interpretationen prägt den Lebensalltag vieler Menschen dieser Tage weit mehr als die totalitäre Kontrolle dessen, was verfügbar ist. Was fehlt sind Fokus und Orientierung. Und genau hier entwickelt das Radio seine Stärke. Denn dort geht es allein ums Hören. Tatsächlich wurde nicht Multi-Media zum heißesten Trend der vergangenen Jahre. Diese Feuerwerke aus Wörtern, Bildern und Tönen, die der eigenen Vorstellungskraft kaum Raum geben, lassen viele Nutzer kalt. Nein, der neue Renner ist der Podcast. Gerade junge Leute, deren Mobiltelefone ständig pingen, rütteln und blinken, bedienen sich in großem und stetig wachsendem Maße dieser Vermittlungsform für Journalismus, Bildung, Information und Unterhaltung. Kaum jemand, der von sich reden machen möchte, kommt heute ohne Podcast aus. Und vom Podcast bis zum Radio ist es nicht weit. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Man erinnert sich an die 80er Jahre, die Privatradios drängten auf den Markt. Und man hört sie noch klagen, die Journalisten mit Sendungsbewusstsein: Das Ende des Wortes sei nahe. Musik überall, und die auch noch ausgewählt vom Computer, in Textform nur noch Hör-Häppchen, kaum länger als zwei Minuten, so werde die Sache laufen. Dann wurden die Info-Wellen geboren. Nachrichten rund um die Uhr, so viel Wort war nie. Aber das Publikum teilte sich. Endlich hatte es die Wahl. Und nun ist der Podcast da, den wieder niemand hat kommen sehen. Im Nachhinein lässt sich die neue Liebe zum Hören gut erklären. Hörstücke bieten Orientierung und Ruhe in einer Welt der Kakophonie. Sie ermöglichen es, sich ganz auf ein einziges Thema zu konzentrieren und das sogar über längere Zeit. Sind sie gut, dann finden sie ganz entspannt den richtigen Ton. Sie machen Information nahbar, zuweilen persönlich. Und sie dürfen ruhig ordentlich lang sein. Mal 20 Minuten, gar eine Stunde einem Sujet zu folgen, fällt vielen Menschen offenbar gar nicht schwer. Aufmerksamkeit statt Aufmerksamkeits-Ökonomie, die Sehnsucht danach scheint groß zu sein. Denn wenn nicht alle Sinne gleichzeitig strapaziert werden, kann man sowohl den Verstand als auch die Gefühle auf Reisen schicken. Die Augen haben Pause. Gleichzeitig verschlingt das Hören nicht alle Energie. Man kann einen Podcast hören, damit etwas über die Welt lernen, und gleichzeitig Autofahren, trainieren, staubsaugen, den Hund ausführen oder kochen. Eine Generation, die vom ständigen Gefühl geplagt ist, etwas zu versäumen, schätzt diese ruhige Art des Multi-Tasking. Radiomacher sollten dies als Stärke nutzen, denn nun können sie beides: Einerseits diejenigen linear durch den Tag führen, die keine Lust auf ständigen Entscheidungszwang haben, andererseits denjenigen Freiheit gewähren, die gerne selbst auswählen, wann sie sich was zu Gemüte führen wollen. Manchmal ist dies ein und dieselbe Person nur zu unterschiedlichen Zeiten. Das Radio erfüllt damit gleich zwei Bedingungen einer freiheitlichen Gesellschaft: Es stiftet Gemeinschaft und ermöglicht Individualität. Und dies tut es besser als je zuvor. Mehr noch als andere Medien ist Radio demokratisch und inklusiv. Zugang hat jeder, auch ohne teures Empfangsgerät. Man muss nicht lesen können, um Schlaues zu hören, nicht einmal gut sehen. Das auf den Ton reduzierte Format zwingt Expertinnen und Experten, so zu sprechen, dass es alle verstehen. Und Stimmen bilden Vertrauen. So, wie der Charite-Virologe Christian Drosten im NDR-Podcast das Coronavirus erklärte, konnte kaum ein anderer den Informationshunger stillen. Mehr als 60 Millionen Abrufe verzeichnete das Coronavirus Update Stand September. Der deutsche Pandemie-Frühling hatte einen Radio-Star. Radio hat noch weitere Stärken, die zum freiheitlichen Leben gehören. Zum Beispiel gestattet es Privatsphäre. Der Studiogast trägt Jogginghose, die Interviewpartnerin Cowboy-Stiefel? Es wird allen verborgen bleiben. Radio-Moderatorinnen dürfen ohne Botox altern, worum ihre Fernseh-Kolleginnen noch ringen müssen. Und wer dem Radio-Reporter ein Straßen-Interview gibt, dessen Anonymität bleibt einigermaßen gut geschützt. Menschen fällt es leichter, sich für das Radio zu öffnen, als sich vor laufenden Kameras zu offenbaren. Denn, wie es in analogen Zeiten unter Journalisten so schön hieß: Das meiste versendet sich. Unter dem Schutz des Flüchtigen und Unsichtbaren lässt das Radio viel Raum für Nähe und Intimität. Radio überwindet Grenzen und stiftet Gemeinschaft auch dort, wo es Worte und Wörter nicht schaffen: mit Musik. Melodien und Rhythmen aller Epochen verorten Hörerinnen und Hörer in Generationen, Schichten und Kulturräumen, geben Identität und Geborgenheit. Musik ruft alte Gefühle wach und weckt gleichermaßen Lust auf Neues, erweitert den Geschmack und Horizont. Sie spiegelt uns in unserer Fülle und Menschlichkeit, wie es das gedruckte Wort allein nicht schaffen wird. Ohne Musik ist Radio nicht denkbar. Radio bildet die Königsdisziplinen im Journalismus ab: Es versorgt sein Publikum mit Vertrautheit und Überraschung zugleich. Die Stimme der Moderatorin, die Nachrichten zur vollen Stunde, beides strukturiert den Alltag, man kann sich daran orientieren. Die Beiträge darum herum sind das Überraschungspaket, das den Tag mit Leben füllt. Mühelos wandert das Programm von fern nach nah, von global nach lokal, macht Angebote, in die man sich bei Interesse vertiefen, über die man bei Desinteresse hinweghören kann. Gutes Radio bietet an, aber drängt sich nicht auf. Das Radio respektiert den mündigen Bürger – und dieser Respekt steht im Kern der Demokratie. Es lässt Raum, selbst wenn es ihn füllt. Es strotzt vor Vielfalt aber erlaubt Gemeinschaft. Es informiert, bildet, unterhält, beglückt und spricht damit den Menschen als Ganzes an. In der neuen Radio-Welt entscheiden die Hörenden: Sie können das Programm digital in Einzelteile zerlegen aber auch linear genießen. Sie können suchen, aber auch einfach nur finden. Dass sie die Wahl haben, darauf kommt es an.
Essay von Alexandra Borchardt
#5055 / O-Ton / mit Geodaten / Dokublog
